Vor dem fünften Jahrestag ihres weltberühmt gewordenen Klimastreiks hat
die schwedische Aktivistin Greta Thunberg zu einem noch stärkeren Kampf gegen die Klimakrise und weiteren Druck von der Straße aufgerufen. „Wir brauchen radikalen Klimaschutz“, fordert die heute Zwanzigjährige .
Radikal will es die Mehrheit der Deutschen allerdings nicht. Laut einer Umfrage vom SWR vom Juni 2023 lehnen 85 Prozent der Befragten die Straßenblockaden und weitere Protestformen von Last Generation ab.
Und doch lässt sich nicht mehr bestreiten: Der Klimawandel ist da! Auch 2023 haben extreme Wetterereignisse global für Schlagzeilen gesorgt. Millionen Menschen waren betroffen und die Schäden gehen erneut in die Milliarden.
So tobten in Griechenland diesen Sommer die schlimmsten Waldbrände der Geschichte. Bis zu 44 Grad Celsius wurden im Landesinneren gemessen. Der gesamte Mittelmeerraum stöhnte unter einer noch nie dagewesen Hitze. Österreich, Kroatien und Slowenien erlebten im August die fatalste Flutkatastrophe seit Jahrzehnten. Die Bilder ähneln denen aus dem Ahrtal, als sich im Juli 2021 nach sintflutartigen Regenfällen die beschauliche Ahr in einen tödlichen Strom verwandelte. Das zuvor beschauliche Flüsschen riss 134 Menschen in den Tod und zerstörte dutzende Ortschaften. Ähnliche dramatische Bilder erreichten uns von der anderen Seite des Erdballs. Die Buschbrände auf Hawai, Extremwetter wie Hitze, Frost, Wirbelstürme und Starkregen an der Westküste von Südamerika, Südasien und Australien … das Klima schien und scheint überall aus den Fugen zu geraten. So warnte der UN-Generalsekretär Guterres auf der Sitzung des Weltklimarates im März 2023: „Die Klima-Zeitbombe tickt “.
Alles nur Panik, wie viele noch immer meinen? Oder doch Zeit für ein radikales Umdenken und drastische Sofortmaßnahmen wie es unter anderem Luisa Neubauer und Fridays von Future fordern?
Ein genauer Blick hinter den Vorhang von Mutter Erde lohnt daher allemal. Was sind die Ursachen und Folgen des Klimawandels? Wo stehen wir heute und was kommt noch auf uns zu? Was kann jeder Einzelne tun? Und vor allem: Was ist das überhaupt, das Klima? Der Klimawandel?
Was sind Klima und Klimawandel?
Der Begriff Klima bezeichnet die Gesamtheit aller Wetterereignisse, die über einen längeren Zeitraum (Jahre oder Jahrzehnte) in einem größeren Gebiet stattfinden.
Der übliche Wetterverlauf wie Sonne, Wind, Temperatur, Feuchtigkeit oder Niederschlag während eines Jahres gibt also das Klima wieder.
Das Klima ist nicht mit dem Wetter zu verwechseln. Unser Wetter ist das, was wir tagtäglich wahrnehmen. Es beschreibt den Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Das Klima bezeichnet die Gesamtheit aller Wetterereignisse über Jahre oder Jahrzehnte in großen Gebieten. Fest steht aber: Klima und Wetter hängen stark von der Sonneneinstrahlung ab.

Dieses Klima hat sich im Lauf der Erdgeschichte immer wieder verändert. So gab
es zum Beispiel in der Altsteinzeit eine Eiszeit. Damals war es wesentlich kälter als heute. Solche Wandel sind natürlich und haben verschiedene Ursachen.
Klimaveränderung spürbar schneller
Normalerweise verändert sich das Klima über viele Jahrhunderte in Zeitlupe. Ein Einzelner würde einen solchen Wandel innerhalb seines Lebens nicht bemerken. Aktuell erleben wir jedoch eine globale Erderwärmung, die wesentlich schneller voranschreitet. Und zwar so rapide, dass sich die Temperaturen in der kurzen Zeit eines Menschenlebens verändern. Das Klima rund um den Globus wird für jeden spürbar wärmer.
Ein Blick auf den Anstieg der Durchschnittstemperatur verdeutlicht die Dimension. Betrug er in den zurückliegenden 100 Jahren ungefähr 0,8 Grad Celsius, so müssen wir ohne wirksame Gegenmaßnahmen mit einem Anstieg der Temperaturen um bis zu 6,5 Grad Celsius rechnen.
Europa mit dem weltweit stärksten Temperaturanstieg
Wer den viel beschworenen Temperaturanstieg bisher nur im Gefühl hatte, bekommt hier die Bestätigung: Das Jahr 2022 war „extrem“ warm. Zum achten Mal in Folge lagen die Temperaturen um mehr als 1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Das hat der Copernicus Climate Change Service errechnet.
Der Copernicus-Klimawandeldienst fasst im Auftrag der EU alle Temperaturen, Treibhausgaskonzentrationen und bedeutenden Klima- und Wettereignisse der vorangegangenen zwölf Monate zusammen. Das Ergebnis für 2022: Sowohl in Europa als auch weltweit wurden mehrere Hitze-Rekorde gebrochen. Gleichzeitig waren große Regionen von Dürren, Waldbränden und Überschwemmungen betroffen.
Dabei verzeichnet Europa in den letzten 30 Jahren von allen Kontinenten den stärksten Temperaturanstieg – mehr als doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Was auffällt: Viele dieser Hitzewellen fanden schon im Mai und auch noch im Oktober statt.
Unstrittig ist: Hauptverantwortlich für diese Entwicklung ist der sogenannte Treibhauseffekt. Und ob nun Aktivistinnen wie Thunberg und Neubauer, die UNO unter Guterres oder unzählige Klimaforscher, sie alle warnen: Solange die Nationen und Menschen weiterhin ungebremst Treibhausgase ausstoßen, werden die Temperaturen immer höher ansteigen und in einer globalen Katastrophe enden.
Kommen wir also zum nächsten viel diskutierten Begriff, dem Treibhauseffekt.
Der Treibhauseffekt einfach erklärt
Der natürliche Treibhauseffekt
Anders als es die ständigen Warnungen vor dem Treibhauseffekt vermuten lassen,
ist der natürliche Treibhauseffekt grundsätzlich etwas Gutes. Er bildet die Grundlage für das Lebens auf der Erde. Ohne ihn wäre es auf der Welt eiskalt wie im Weltraum – rund minus 18 Grad Celsius. Zum Vergleich: Heute liegt die globale Durchschnitts-temperatur auf der Erde bei etwa plus 15 Grad Celsius.
Der natürliche Treibhauseffekt macht also einen enormen Unterschied von ungefähr 33 Grad Celsius aus. Er ummantelt die Erde mit einer schützenden Atmosphäre, in der natürliche Treibhausgase die Sonnenstrahlung absorbieren. Genauer gesagt werden die Strahlen größtenteils von der Erdoberfläche reflektiert und ins Weltall zurückgeworfen. Das Resultat: Eine lebensfreundliche Temperatur in weiten Teilen unserer Welt.
Der Effekt der natürlichen Klimagase auf die globale Temperatur ist also erstaunlich groß. Und das obwohl ihr Anteil in der Atmosphäre sehr gering ist. Er liegt bei unter 0,1 Prozent.
Übrigens, für den Fall, dass Sie einmal bei „Wer wird Millionär“ auf dem Stuhl sitzen: Die wichtigsten Treibhausgase für den natürlichen Treibhauseffekt sind Wasserdampf (etwas zwei Drittel) und Kohlendioxid / CO2 (etwa ein Drittel). Einen kleinen Prozentsatz machen Spurengase wie Methan (CH4) aus. Ansonsten besteht unsere Atemluft aus 78 Prozent Stickstoff (N), 21 Prozent Sauerstoff (O2) und einem Prozent Argon (Ar) sowie einigen Spurengasen .
Anthropogener Treibhauseffekt
So wertvolle Dienste die Treibhaus- bzw. Klimagase also leisten, gilt auch hier: Manchmal ist es zu viel des Guten. Und das ist mit Beginn der industriellen Revolution klar der Fall. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts steigt die Konzentration der Treibhausgase in einem noch dagewesenen Maß an, allen voran Kohlendioxid bzw. CO2.
Die Folge: Durch den massiven Ausstoß von Treibhausgasen bleiben immer mehr Sonnenstrahlen in der Atmosphäre hängen. Die Erde erwärmt sich deutlich. Bezeichnet wird dies als anthropogener Treibhauseffekt, also vom Menschen verursacht.
Doch nicht nur die Nutzung fossiler Energiequellen wie Holz, Kohle, Öl und Gas
tragen zur Erderwärmung bei. Auch Eingriffe in die Natur schaden massiv. An erster Stelle zu nennen ist die Rodung von Wäldern, die Kohlendioxid (CO2) in Sauerstoff (O2) umwandeln.

CO2-Konzentration von 1950 bis 2022 vervierfacht
Zur Veranschaulichung wie sehr der Mensch in den vergangenen 200 Jahren auf
die Atmosphäre eingewirkt hat, abschließend noch eine Zahl: Bis ins 19. Jahrhundert betrug die Zusammensetzung der Treibhausgase in der Atmosphäre etwa 280 ppm CO2. Es kamen also 280 Moleküle Kohlendioxid auf eine Million Moleküle Luft. Heute messen Forscher und Wissenschaftler über 410 ppm CO2 . Eisbohrungen ergaben übrigens, dass die natürliche Bandbreite der letzten 650.000 Jahre zwischen 150 und 300 ppm lag.
Die wichtigste Messreihe zum Klimawandel erfolgt seit Jahrzehnten auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawai. Auf 3.300 Metern Höhe können die Klimaforscher weitab jeglicher störenden Kohlendioxidquellen ihrer Arbeit nachgehen. Die Auswertungen des Mauna Loa Observatory sind die Grundlage zur Bestimmung des globalen Kohlendioxid-Anstiegs. Lag dieser in den 1950er-Jahren im Jahresmittel noch bei 0,55 ppm, waren es in den vergangenen 15 Jahren bereits 2,28 ppm pro Jahr. Der globale Ausstoß an Kohlendioxid hat sich also annähernd vervierfacht.
Die Erderwärmung im Jahresdurchschnitt
Die zunehmende Klimaerwärmung wirft ihre Schatten voraus. Mit dem Klimawandel geht eine Erwärmung der Erde einher, die für steigende Temperaturen sorgt. Die Statistik offenbart: Die Abweichung der globalen Lufttemperatur vom Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900 kennt nur eine Richtung: Nach oben.
Auch 2022 reihte sich in die Liste der wärmsten Jahre seit Beginn der Messungen ab 1850 ein. Wie die Weltwetterorganisation (WMO) mitteilte, dürfte es das fünft- oder sechstwärmste Jahr gewesen sein. Eine genaue Rangordnung sei aber schwierig, weil die Unterschiede zwischen einzelnen Jahren oft sehr gering seien, teilte die Organisation mit.
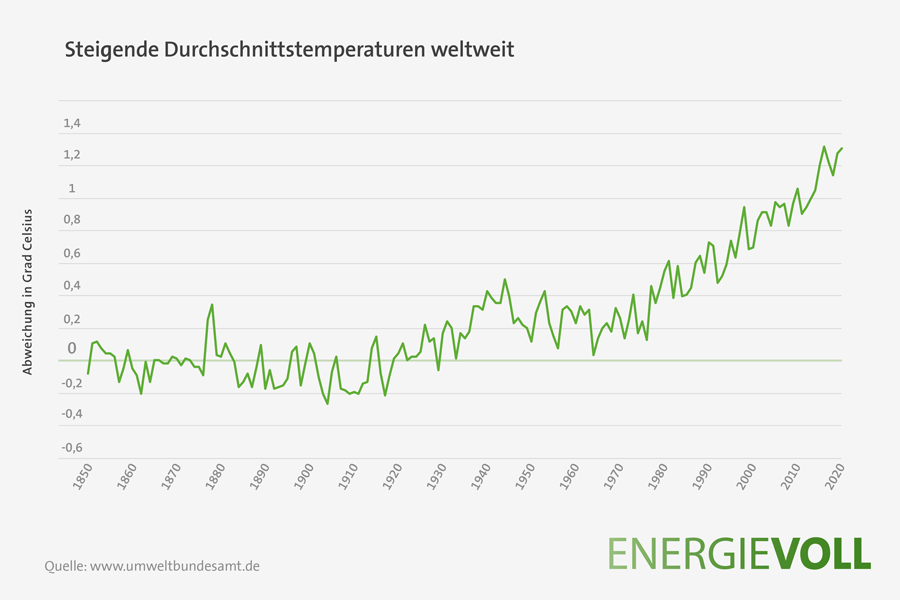
Der Klimawandel in Deutschland
Den Blick auf Deutschland gerichtet, zeigt sich ein vergleichbares Bild. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war 2022 gemeinsam mit 2018 das wärmste Jahr in Deutschland seit 1881 .
Und schon jetzt lässt sich auch für den Sommer 2023 festhalten: Es war wieder viel zu warm … auch wenn es die zum Teil hohen Temperaturschwankungen anders vermuten lassen. Am 15. Juli kamen die Menschen bei 38,8 Grad in Möhrendorf-Kleinseebach in Bayern besonders ins Schwitzen
Wie der DWD in einer vorläufigen Bilanz mitteilt, lag die Durchschnittstemperatur zwischen Juni und August 2023 bei 18,6 Grad Celsius. Das sind 2,3 Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 1990. Damit werden nun in Deutschland seit 27 Jahren viel zu warme Sommer gemessen.
Noch eine Zahl, die nachdenklich stimmt: Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter hatte sich Deutschland allein vergangenes Jahr um 1,7 Grad Celsius erwärmt. Und das obwohl sich fast alle Staaten im Pariser Klimaabkommen 2015 darauf geeinigt haben, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Nur so lassen sich schlimmere Auswirkungen der Erderhitzung vermeiden.
Hat Deutschland also das Klimaziel verfehlt? Nicht direkt. Denn der in Paris beschlossene Wert bezieht sich auf die globale Durchschnittserwärmung. Und diese liegt derzeit bei 1,1 bis 1,2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Hierzulande ist die mittlere Erwärmung jedoch höher, weil es über Kontinenten und Landmassen generell wärmer ist als über Ozeanen.
Dennoch warnt der Weltklimarat in seinem aktuellen Bericht vom 20. März 2023:
„Das 1,5 Grad-Ziel ist gescheitert. Ohne sofortige drastische Minderungen der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen wird das Ziel, unter 1,5 Grad durch Menschen verursachte Erderwärmung zu bleiben, bereits in den 2030er-Jahren gerissen.“
Hohe CO2-Emissionen in Deutschland
Jeder von uns kann den Klimawandel live erleben. Und wir müssen endlich vom Handeln ins Reden kommen. Das bedeutet vor allem, den C02-Ausstoß drastisch zu reduzieren. Das ist jedoch gerade für Industrienationen wie Deutschland leichter gesagt als getan. Unser Bedarf an Energie wird noch überwiegend durch die Verbrennung fossiler Energieträger sichergestellt.
Wie abhängig die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft von Gas, Öl und Kohle sind, hat der Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 gezeigt. An ein sofortiges Gasembargo trauten sich weder Berlin noch Brüssel heran. Zu schnell wären die Lichter in Europa ausgegangen. Als dann die Gaspipelines Nordsteam 1 und Nordstream 2 vergangenen September in die Luft gesprengt wurden, ging in Deutschland die Angst vor einem dunklen und bitterkalten Winter um.
Am Ende traf nichts davon ein und der Bundesregierung gelang es, mit Robert Habeck an der Spitze, alternative Bezugsquellen zu erschließen. So bezieht Deutschland aktuell sein Gas überwiegend aus Norwegen, den Niederlanden
und Belgien.
Ein Happy End für die Wirtschaft und Verbraucher? Abgesehen von den gestiegenen Energiekosten vielleicht. Aber bestimmt nicht für das Klima. Obwohl Deutschland seinen CO2 Ausstoß in den letzten Jahrzehnten deutlich senken konnte, hat es 2021 mit knapp 796 Millionen Tonnen fast 2 % der weltweiten Emissionen verursacht. Das ist Platz sieben unter allen Ländern dieser Erde .
Pro Kopf jährlich 9,2 Tonnen CO2
Auch beim Pro-Kopf-Ausstoß ist die Bilanz keine besonders erfreuliche. Laut dem Klimaschutzbericht der Bundesregierung aus 2022 emittiert jeder Bundesbürger pro Jahr 9,2 Tonnen des Klimakillers CO2. Im globalen Durchschnitt sind es lediglich 7,5 Tonnen.
Besondere Sorgenkinder beim Bemühen um eine nationale CO2-Reduktion sind für das Umweltbundesamt (UBA) die Sektoren Verkehr und Gebäude. So lagen diese 2022 erneut über der im Bundesklimaschutzgesetz festgelegten Obergrenze. Ausgestoßen wurden rund 148 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das waren rund 1,1 Millionen Tonnen (0,7 Prozent) mehr als 2021 und rund neun Millionen Tonnen mehr als vorgegeben (138,8 Millionen Tonnen). Als Gründe nannte UBA-Präsident Prof. Dirk Messner die Zunahme des Pkw-Verkehrs nach Aufhebung der Corona-Einschränkungen und den Tankrabatt vom Sommer.
Eine Klimawende braucht also unbedingt auch eine Verkehrswende. So spielt die Elektromobilität eine Schlüsselrolle beim Erreichen der Klimaschutzziele.
Auch der Energiesektor riss 2022 laut UBA die Zielmarke. Statt CO2 zu senken, stiegt der Ausstoß um 4,4 Prozent auf rund 256 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten. Grund sei trotz der Einsparungen beim Erdgas durch den Ukraine-Krieg ein vermehrter Einsatz vor allem von Stein- und Braunkohle zur Stromerzeugung. Gebremst wurde dies durch die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Diese stieg um neun Prozent.
Klimakiller: Massentierhaltung und Fleischkonsum
Qualmende Schornsteine auf den Fabriken und Hausdächern. Die Abgase von Millionen Pkw. Tief in die Erde ragende Braunkohlereviere. Lange Schlangen vor
den Schaltern der Fluggesellschaften in der Ferienzeit. Bei den Ursachen für den Klimawandel haben die meisten vor allem diese Bilder im Kopf. Dabei gibt es einen weiteren großen Klimakiller, der in aller Munde ist, aber nur wenigen bewusst: Fleisch.
Insbesondere die Massentierhaltung schlägt in der Klimabilanz negativ zu Buche. Hier werden mehr Treibhausgase frei als im Verkehr. Bei der Verdauung des Futters. rülpsen und pupsen die Rinder Methan in die Atmosphäre. Und dort richtet es weitaus mehr Schaden an als Kohlendioxid. Methan ist für das Klima zehn- bis zwanzigmal schädlicher als CO2. Zudem ist die Tierhaltung weltweit die größte Triebkraft für die Abholzung der Wälder, um Futtermittel anzubauen.
Allein in Deutschland sind das mehr als fünf Millionen Hektar Ackerfläche – das ist knapp ein Drittel der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche. Das meiste ist Futterweizen, Futtergerste und Futtermais. Diese Kulturen werden in intensivem Ackerbau, das heißt mit einem hohen Input an Stickstoff und anderen Düngernährstoffen, angebaut. Diese sind fast 300-mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid .

Pro Kilogramm Rindfleisch 9,2 Kilogramm C02
Pro Kilogramm erzeugten Rindfleisch fallen laut WWF 25,5 Kilogramm Kohlendioxid / CO2-Äquivalente an. Dahinter kommen Fleisch vom Schwein und Geflügel mit 10,3 bzw. 9,2 Kilogramm und tierische Lebensmittel wie Milch oder Eier mit rund 7 Kilogramm.
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) macht die Massentierhaltung für 4,5 Prozent der von Menschen verursachten Treibhausgase verantwortlich. Das unabhängige Worldwatch Institut kommt sogar auf 51 Prozent.
Ohne Fleisch 75 Prozent weniger Klimaerwärmung
Wie sehr der weltweite Fleischkonsum das Klima konkret belastet, haben jüngst Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Oxford errechnet. Laut dem Forscherteam handelt es sich bei der Untersuchung um die erste überhaupt, welche die Auswirkungen der Ernährungsweise auf andere Umweltmaßnahmen im Detail analysiert. Erschienen ist die Studie Juli 2023 im Fachmagazin Natur Food.
Demnach erzeugt ein Mensch, der jeden Tag mehr als 100 Gramm Fleisch isst,
im Schnitt 10,24 Kilogramm Treibhausgase pro Tag. Im Umkehrschluss führt eine vegane Ernährung zu 75 Prozent weniger Klimaerwärmung. Der Verzicht auf Fleisch und tierische Produkte reduziert zudem die Zerstörung der Biodiversität um 66 Prozent und den Wasserverbrauch um 54 Prozent, so das Ergebnis der Studie.
Nun lautet der Appell keinesfalls, komplett auf Fleisch zu verzichten. Aber wer seinen Fleischkonsum reduziert, fördert nicht nur seine Gesundheit, sondern auch massiv die Umwelt.
Klimafreundliche Ernährung als Ziel der Bundesregierung
Entsprechend greift auch die Politik das heiße Thema zunehmend auf. Ein anschauliches Beispiel liefern die Vorstöße aus dem Bundesumweltministerium aus dem Jahr 2022. Bundesminister Cem Özdemir drängt auf eine stärker pflanzenbasierte Ernährung. Das zugehörige Eckpunktepapier „Weg zur Ernährungsstrategie der Bundesregierung“ hat das Kabinett bereits im Dezember 2022 verabschiedet. Die Ernährungsstrategie soll bis Ende 2023 beschlossen werden.
Özdemir weist darauf hin, dass über die Hälfte der landwirtschaftlichen Treibhausgas-Emissionen in Deutschland durch Tierhaltung entstünden. Gleichzeitig sehe das Klimaschutzgesetz eine Absenkung der jährlichen Emissionen in der Landwirtschaft bis 2030 auf 56 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente vor. Zu schaffen sei das nur, wenn die Tierbestände sowie die Anbauflächen für Tierfutter zurückgehen.
Die Folgen von Klimawandel und Erderwärmung
Auch wenn die Folgen des Klimawandels in Deutschland und Europa zurzeit noch als vergleichsweise moderat bezeichnet werden können: Auf Dauer entkommt dem Klimawandel niemand. Die globale Erderwärmung wird alle Weltregionen vor große Herausforderungen stellen. Allerdings werden nicht alle Gegenden der Erde gleich betroffen sein. In einigen Regionen kann es häufiger zu extremen Wetterereignissen und zunehmenden Niederschlägen kommen als in anderen. Demgegenüber wird es in anderen Bereichen der Erde verstärkt zu Hitzewellen und Dürren kommen.
Zu den wichtigsten Folgen des vom Menschen verursachten Klimawandels zählen:
- Steigende Minimaltemperaturen
- Steigende Maximaltemperaturen
- Höhere Meerestemperaturen
- Steigender Meeresspiegel
- Vermehrte Starkniederschläge
- Gletscherschmelze
- Auftauender Permafrost
Globales Artensterben
Hitzewellen, Waldbrände, ausgetrocknete Flüsse und Felder und dann wiederum sintflutartige Regenfälle und katastrophale Hochwasser: Die Zunahme extremer Wetterphänomene sehen wir täglich im Fernsehen und bekommen sie oft selbst hautnah zu spüren.
Ein Prozess, der hingegen weitestgehend unbeobachtet und im Stillen vor sich geht, ist das Artensterben. Leider werden die Klima- und Biodiversitätskrise in der Öffentlichkeit noch immer als zwei getrennte Katastrophen wahrgenommen.
Dabei ist erste hauptverantwortlich für einen Rückgang der Artenvielfalt, wie ihn
der Mensch noch nicht erlebt hat.

Fast ein Drittel aller Pflanzen und Tiere bedroht
Derzeit stehen weltweit über 147.000 Arten auf der Roten Liste der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN). Mehr als 41.000 Arten sind akut vom Aussterben bedroht – davon 41 Prozent der Amphibien, 38 Prozent der Haie und Rochen, 34 Prozent der Nadelbäume, 33 Prozent der riffbildenden Korallen, 27 Prozent der Säugetiere und 13 Prozent der Vögel.
Fast ein Drittel aller Pflanzen und Tiere drohen für immer zu verschwinden. Das ergab eine Befragung der Universitäten Minnesota und Leipzig von mehr als 3.000 Experten und Expertinnen, die im Sommer 2022 veröffentlicht wurde.
Verschiedene Studien zeigen, dass bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad das Aussterberisiko von Tieren und Pflanzen um 4 Prozent steigt – bei einer Erwärmung von 3 Grad aber schon auf 26 Prozent.
Beispiel Meeresschildkröte und Kabeljau
Weil das alles so weit entfernt von unserem Alltag ist und sich viele nicht vorstellen können, was gerade mit der Tier- und Pflanzenwelt passiert, zwei konkrete Beispiele: Bei den Meeresschildkröten beeinflusst die Bruttemperatur, welches Geschlecht ein Embryo entwickelt. Durch die Erwärmung der Meere schlüpfen zunehmend nur noch weibliche Tiere. Die gepanzerten Tiere können sich also nicht mehr so gut fortpflanzen und die Populationen schrumpfen. Oder Fische in der Nord- und Ostsee wie der Kabeljau: Da die Gewässer wärmer werden, laichen sie früher im Jahr – zu dieser Zeit ist das Nahrungsangebot jedoch schlechter und mehr Larven verhungern.
Auswirkungen auf die Ozeane
Als dramatisch sind die Folgen des Klimawandels auf die Ozeane zu bezeichnen. Unsere Meere wirken zwar als große Kohlendioxidsenke und können rund ein Drittel des durch die Menschen freigesetzten Kohlendioxid (CO2) aufnehmen. Diese Aufnahmefähigkeit sinkt jedoch. Die Erderwärmung sorgt für einen Anstieg des Meeresspiegels – unter anderem durch die thermische Ausdehnung der Wassermassen. Toxische Algenblüten und Korallenbleiche sind weitere Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt.
Im Zuge des Klimawandels schwächt sich der Golfstrom ab und setzt einen Mechanismus in Gang: Mit dem Anstieg der globalen Temperatur erwärmt sich auch das Wasser. Dadurch wiederum wird das Abschmelzen der Pole an Arktis und Antarktis sowie des Grönlandeises beschleunigt. Alles das sorgt dafür, dass der Salzgehalt des Meerwassers sinkt. Gleichzeitig taut der Permafrostboden auf und setzt eine Menge Methan, Stickstoff und Phosphor frei – damit beschleunigt sich der Treibhauseffekt zusätzlich. Der Klimawandel erhöht auch den Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre und macht die Verfügbarkeit von Wasser weniger berechenbar.
Immer mehr Naturkatastrophen
Erderwärmung und Treibhauseffekt – also der Klimawandel – werden zunehmend auch als Ursache von Naturkatastrophen genannt. Ein Bericht der Vereinten Nationen (UN) spricht für den Zeitraum von 2000 bis 2019 von 4,2 Milliarden Betroffenen und 1,2 Millionen Toten. Im Vergleich mit früheren Erhebungen hat sich diese Zahl verdoppelt. Als Ursachen werden Überschwemmungen, Stürme, Dürren, Waldbrände und Hitzewellen genannt. Der wirtschaftliche Schaden belief sich auf drei Billionen US-Dollar.
110 US $ Schaden allein im ersten Halbjahr 2023
Und auch für das laufende Jahr sieht die Bilanz düster aus. So berichtet der weltgrößte Rückversicherer, die Münchener Rück, für das erste Halbjahr 2023 von Gesamtschäden in Höhe von 110 Mrd. US$. Das liegt über dem 10-Jahres-Durchschnitt .
Besondere Erwähnung findet in dem Bericht der Münchener das natürliche Klimaphänomen El Niño. Die Temperaturschaukel im Pazifik dürfte in vielen Regionen der Welt die Wetterextreme und Erderwärmung noch mehr anheizen.
Was kann ich gegen den Klimawandel tun?
Die Ambitionen sind groß. Deutschland peilt in puncto Klimaschutz genaue Zielvorgaben[DH1] an: Das Klimaschutzziel der Bundesregierung sieht vor, bis 2030 die Treibhausgasemissionen gegenüber dem Jahr 1990 um 65 Prozent zu verringern. 2040 soll dieser Betrag mindestens 88 Prozent ausmachen.
2045 soll Deutschland schließlich komplett auf Treibhausgase verzichten.
Doch was kann der Einzelne abseits der großen UN-Klimakonferenzen, wie zuletzt im November 2022 in Sharm el-Sheikh und diesen Dezember in Dubai, tun, damit wir schnellstmöglich klimaneutral werden? Denn auch wenn es bequem erscheint, auf die Entscheidungen und Vorgaben der Politik zu warten: Der Kampf gegen den Klimawandel beginnt bei jedem Einzelnen von uns.
Deswegen zum Abschluss 10 Tipps, was Du für das Klima und gegen den Klimawandel tun kannst:
- Beziehe Ökostrom
- Fahre mit Rad, Bus oder Bahn zur Arbeit
- Iss weniger Fleisch
- Verzichte auf Kurzstreckenflüge
- Vertraue auf Bio-Produkte aus kaufe regional ein
- Drehe Deine Heizung ein wenig herunter
- Wasche mit voller Maschine und niedrigen Temperaturen
- Achte bei Elektrogeräten auf den Stromverbrauch
- Verzichte auf den Stand-by-Modus
- Nutze LED-Leuchten statt Glühbirnen


